
Anwendungen in der Telematikinfrastruktur: Das alles gehört zur TI
Ziel der Telematikinfrastruktur (TI) ist eine sichere digitale Vernetzung aller Akteure und Akteurinnen in der medizinischen Versorgung – inklusive der Patienten und Patientinnen. Dank der Telematikinfrastruktur werden medizinische Informationen ohne Zeit- und Datenverlust ausgetauscht. Damit das gelingt, gibt es für verschiedene Aufgaben unterschiedliche Anwendungen.
Überblick über die TI-Anwendungen
Welche Vorgeschichte hat die Patientin? Welche Medikamente nimmt der Patient? Gibt es Unverträglichkeiten? Irgendjemand hat diese Informationen, aber wer? Derzeit ist es aufwendig, umfassende medizinische Informationen über Patienten und Patientinnen zu erhalten. Selbst Hausärzte und Hausärztinnen sind häufig überfragt. Das ändert sich mit der Telematikinfrastruktur (TI) im Gesundheitswesen: Alle Akteure und Akteurinnen werden digital miteinander vernetzt. So wird sichergestellt, dass sämtliche relevanten Gesundheitsdaten auf dem aktuellen Stand vorliegen und jederzeit das Richtige getan werden kann.
Die verschiedenen TI-Anwendungen greifen ineinander, um die bestmögliche Kommunikation und Behandlung zu ermöglichen. Dazu zählen:
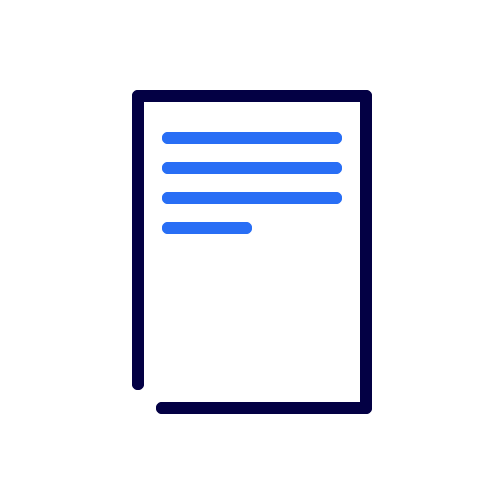
Die elektronische Patientenakte (ePA)
In der elektronischen Patientenakte für alle, kurz ePA für alle, werden alle relevanten medizinischen Daten von Patienten und Patientinnen gespeichert. Seit Anfang 2025 wurde für alle gesetzlich Versicherten automatisch eine ePA für alle angelegt – es sei denn, sie widersprechen mit der sogenannten Opt-Out-Möglichkeit. Medizinische Einrichtungen sind aufgefordert, sich bis zum 1. Oktober 2025 mit den Funktionen vertraut zu machen und die ePA in ihren Einrichtungsalltag zu integrieren. Die elektronische Patientenakte bündelt sämtliche wichtigen Gesundheitsdaten, also beispielsweise Arztbriefe, Medikationen oder Befunde. Medizinisches Personal kann im Behandlungskontext bei gesetzlich Versicherten auch ohne die explizite Zustimmung auf diese Daten der Patienten und Patientinnen zugreifen. Das erlaubt einen schnellen Überblick über die gesamte Anamnese und darauf aufbauend eine zielführende Behandlung.

KIM: Kommunikation im Medizinwesen
Nachrichten und Dokumente im Gesundheitswesen werden per E-Mail via KIM ausgetauscht. Dabei erfolgt der Versand in einem geschützten Netz – der Telematikinfrastruktur (TI). Nur registrierte und authentisierte TI-Nutzende haben Zugriff. Unter anderem können folgende Dokumente ausgetauscht werden:
- Befunde wie Labordaten oder Röntgenbilder
- eArztbriefe
- Heil- und Kostenpläne
- Abrechnungen
- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
TI-Nutzer verfassen über KIM wie gewohnt E-Mails, mit Anhang oder auch ohne. Nur wer ebenfalls in der TI registriert ist, kann KIM-Mails empfangen.
Mitarbeitende in Einrichtungen des Gesundheitswesens können über den Institutions- und Praxisausweis SMC-B oder dessen Variante HSM-B KIM-Nachrichten im Namen ihrer Einrichtung empfangen und versenden. Für das Versenden von persönlichen KIM-Nachrichten wird ein elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) oder Berufsausweis (eBA) benötigt.
Versandte Nachrichten werden an das KIM-Clientmodul übertragen, vergleichbar mit einem SMTP-Server, wo sie verschlüsselt und signiert werden. Anschließend erfolgt der eigentliche Versand der Gesundheitsdaten über den Mailserver, den KIM-Fachdienst. Das Clientmodul entschlüsselt die Nachricht, sodass Empfänger und Empfängerinnen die Nachricht als Klartext sehen.

Der TI-Messenger
Als Alternative zur E-Mail via KIM wird derzeit der TI-Messenger als neuer Standard ausgerollt. Er erlaubt das Instant Messaging auf Smartphone, Tablet und Desktop. Der TI-Messenger orientiert sich am Matrix-Protokoll und gewährleistet:
- Interoperabilität, also sektoren- und anbieterübergreifenden Austausch,
- Integrität aufgrund des hohen Out-of-the-box-Sicherheitsniveaus und nicht zuletzt
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Der TI-Messenger erlaubt schnelle Rückfragen etwa zu Medikationen oder Laborbefunden. Auch Bitten um Rückrufe können als Textnachrichten gestellt werden. Über den TI-Messenger lassen sich allerdings auch größere Datenmengen verschicken.
Die gematik als treibende Kraft hinter der Digitalisierung des Gesundheitswesens hat bereits mehrere Anbieter zertifiziert, die den hohen Sicherheitsansprüchen für TI-Messenger genügen. Im ersten Schritt kommunizieren die Leistungserbringer per TI-Messenger miteinander. Noch 2025 will die gematik auch die Versicherten ins Messaging-System einbinden.

Das E-Rezept
Ausgestellte E-Rezepte werden durch die Telematikinfrastruktur digital verfügbar gemacht. Durch Stecken der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) des Patienten oder der Patientin in das E-Health-Kartenterminal, kann der Apotheker bzw. die Apothekerin sehen, um welche verschriebenen Medikamente es sich handelt – und sie aushändigen. Alternativ können E-Rezepte per App digital einer Apotheke zugewiesen und eingelöst werden: Patienten und Patientinnen können den Rezeptcode auf ihrer App vorzeigen. Papier? Überflüssig.
Noch gibt es E-Rezepte auch als Ausdruck mit Rezeptcode. Das Fachpersonal in der Apotheke scannt den Rezeptcode ab und händigt die Medikamente aus.

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
Die Krankschreibung auf Papier wird selten und verschwindet bald: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden jetzt digital ausgestellt. Dabei geben Ärzte und Ärztinnen über die Telematikinfrastruktur sämtliche Krankschreibungen per KIM an die jeweiligen Krankenkassen weiter. Dort können sie von den Arbeitgebern abgerufen werden. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
- enthält den Namen der versicherten Person,
- unterscheidet zwischen Erst- und Folgebescheinigung,
- terminiert Anfang und Ende der Arbeitsunfähigkeit und
- nennt weder Namen des Arztes oder der Ärztin noch die Diagnose.
Für Privatpatienten und -patientinnen gibt es bislang keine eAU. Sie nutzen weiterhin die Papierversion der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

Elektronischer Medikationsplan (eMP)
Der E-Medikationsplan, kurz eMP, ermöglicht den Leistungserbringern im Gesundheitswesen, mehr Transparenz zu den eingenommenen Medikamenten zu erhalten. Er enthält einen strukturierten Überblick, welche Medikamente ein Patient oder eine Patientin aktuell einnimmt. Darüber hinaus enthält der elektronische Medikationsplan wichtige Zusatzinformationen, um beispielsweise unerwünschte Wechselwirkungen wie etwa bei Allergien zu vermeiden. Durch die Übergabe ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erlauben die Versicherten ihren behandelnden Ärzten und Ärztinnen, Zahnärzten und Zahnärztinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sowie Kliniken oder Apotheken den Zugriff auf ihren E-Medikationsplan.
Der elektronische Medikationsplan wird auf Wunsch von Versicherten geführt. Meist erstellt der Hausarzt oder die Hausärztin diesen eMP. Die standardisierten Vorgaben für diese Datensätze liefert die Telematikinfrastruktur.

Das Notfalldatenmanagement (NFDM)
Medizinische Informationen, die bei Notfällen relevant sein können, werden dank des Notfalldatenmanagements direkt auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert. Dies ist eine freiwillige Leistung. Diese Notfalldaten von Versicherten können gespeichert werden:
- Diagnosen
- Medikationen
- Allergien & Unverträglichkeiten
- Organspendeausweise
- Patientenverfügungen
- Vorsorgevollmachten
- Kontaktdaten & besondere Hinweise
Ähnlich wie beim elektronischen Medikationsplan erstellt meist der Hausarzt oder die Hausärztin die Erstanlage des NFDM. Auch hier erleichtern standardisierte TI-Vorlagen das Erstellen der Datensätze für die Notfalldaten.

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES)
Digitale Informationen müssen ebenso verlässlich stimmen wie solche auf Papier. Das garantiert die qualifizierte elektronische Signatur. Die QES ist als sicherste Form des digitalen Unterschreibens rechtlich der Unterschrift per Hand gleichgestellt und ist im Gesundheitswesen immer an den elektronischen Heilberufsausweis oder Berufsausweis gekoppelt. Qualifizierte elektronische Unterschriften sind bei eArztbriefen und beim Ausstellen von E-Rezepten oder elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) ebenso verpflichtend wie beim Anlegen der Datensätze für das Notfalldatenmanagement (NFDM).
Jede qualifizierte elektronische Signatur ist an die dazugehörige TI-Identität gebunden, wodurch die QES sicher wird.
Sie möchten die vielfältigen Anwendungen der Telematikinfrastruktur nutzen? Informieren Sie sich auf unseren Zielgruppenseiten zum weiteren Vorgehen!

Die eVerordnung
Die eVerordnung für Heil- und Hilfsmittel erlaubt es Ärzten und Ärztinnen zukünftig, diese elektronisch auszustellen und direkt an die Krankenkasse sowie an die eGK der Patienten und Patientinnen zu übermitteln. Unter anderem auch physiotherapeutische Praxen, Sanitätshäuser, Apotheken und die Hersteller von Hilfsmitteln profitieren so von den schnelleren Abläufen und Abrechnungen mit der TI. Dabei wird der Begriff „Hilfsmittel“ weit gefasst: Brillen und Hörgeräte sind ebenso gemeint wie Gehhilfen und Rollstühle, Bandagen und orthopädische Schuhe. Rezepte für Heilmittel umfassen unter anderem Verschreibungen für Physiotheraphie, Logopädie und Podologie.
Die eVerordnung für Heil- und Hilftsmittel wird in mehreren Schritten eingeführt. Das Projekt startete 2024, seinerzeit begrenzt auf orthopädische Hilfsmittel. Ab Januar 2027 gilt die eVerordnung für sämtliche Heil- und Hilfsmittel sowie Verbandmittel, Harn- und Blutteststreifen, Medizinprodukte sowie bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung, ab Juli 2027 wird die elektronische Verordnung auch für die Soziotherapie verpflichtend.

Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)
Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) erlaubt es, die Stammdaten von Versicherten auf deren elektronischer Gesundheitskarte – abgekürzt: eGK – online zu prüfen und zu aktualisieren. Zu den Versichertenstammdaten zählen
- Persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum, Adresse und Geschlecht
- Informationen zur Krankenversicherung
- Angaben zum Versicherungsschutz
Die Prüfung der Versichertenstammdaten ist quartalsweise bei jedem Kontakt zwischen ärztlichem Personal und Patient bzw. Patientin verpflichtend. Aktualisierte VSDM-Informationen werden per Telematikinfrastruktur automatisch auf die eGK übertragen. Der Vorteil des Versichertenstammdatenmanagements: Es müssen bei Änderungen keine neuen Gesundheitskarten an die Versicherten verschickt werden.
Wer kann die Anwendungen in der TI nutzen?

Die Telematikinfrastruktur vernetzt alle Akteure und Akteurinnen im Gesundheitswesen digital miteinander. Auf den Seiten von D-Trust, einer Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei, erfahren Sie, wer die TI-Anwendungen nutzen kann.
Häufige Fragen zu TI-Anwendungen
Mit der Digitalisierung verändern sich viele Abläufe im Gesundheitswesen. Dabei tauchen naturgemäß Fragen auf. Einige der häufigsten beantworten wir hier.
Um die Telematikinfrastruktur (TI) zu nutzen, braucht es unter anderem einen Zugang über sogenannte Smartcards. Berechtigte Personengruppen können sich über einen elektronischen Heilberufsausweis oder Berufsausweis der TI gegenüber ausweisen. Einrichtungen im Gesundheitswesen und deren Mitarbeiter ohne eHBA / eBA brauchen den Praxis- oder Institutionsausweis SMC-B oder die digitale Variante HSM-B. Diese Smartcards bzw. digitalen Identitäten müssen beantragt und freigeschaltet werden, bevor sie genutzt werden können. Zusätzlich werden Hardware oder Software-as-a-Service Komponenten benötigt, welche Sie über Ihre IT-Dienstleister beziehen können.
Ihr Zugang – ob eHBA, eBA, SMC-B oder HSM-B – regelt, welche Anwendungen der Telematikinfrastruktur Sie nutzen dürfen. Dabei gilt der Grundsatz der Notwendigkeit: Sie können nur so viel an Informationen einsehen, wie Sie brauchen, um Patienten und Patientinnen versorgen zu können. So unterscheiden sich beispielsweise die Einsichtsrechte zwischen Arzt, Apotheke und Physiotherapiepraxis.
Die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen ist auf höchste Sicherheit ausgelegt. Sie ist ein geschlossenes Netz, auf das nur zugelassene Nutzende über Konnektoren per VPN (virtuelles privates Netzwerk) zugreifen können. Die Kommunikation zwischen allen TI-Beteiligten wird durch ein kryptografisches Verfahren verschlüsselt. Um jederzeit höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen, wird dieses Verfahren regelmäßig an die neuesten technologischen Entwicklungen angepasst.














